Richtig Benny, rein rechnerisch tut sich nichts! Aber Lebewesen mathematisch zu berechnen, ist meines Erachtens nicht der richtige Weg.
Was Belgien betrifft: Sie hatten relativ wenig brauchbare Mutterstämme (wenn sie nicht gerade das holländische Gelderländer Blut führten). Was haben sie also gemacht? Wie du richtig sagst: Sie haben auf deutsche Genetik (deutsche Hengste) gebaut, gerne auch im Zusammenhang mit Vollblütern.
Und wo kamen die deutschen Hengste her? Aus deutschen Stutenstämmen, auch wieder im Zusammenspiel mit mehr oder weniger Vollblut. Belgier, teilweise Holländer (auf deren Gelderländer Stutenstämmen auch immer noch sehr viele Pferde zurückgehen) nutzen also unsere Hengste besser als wir. Es ist richtig, dass in der Regel drei, besser vier Generationen ausreichen, um aus dem Nichts etwas herauszustampfen, wenn man nur konsequent genug nach denjenigen Hengsten Ausschau hält, die man für den jeweiligen Zweck braucht. Da ist es eben nicht der Stutenstamm der Mutter, sondern die der Väter (aber selbst das ist, wie ich unten noch schreiben werde, etwas oberflächlich betrachtet). Leichter und zuverlässiger ist es trotzdem, wenn man die guten Eigenschaften schon in der Stute verankert hat.
Was die Trakehner betrifft: Sie haben nach wie vor, wenn man ihre geringe Kopfzahl betrachtet, eine ganz gute sportliche Ausbeute, auch wenn die sich hauptsächlich in der Vielseitigkeit niederschlägt. Alles andere wäre auch ein Wunder gewesen; denn nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht nur der Aderlass der Pferde entscheidend, sondern vor allem auch die Tatsache, dass die alten Züchterfamilien alles aufgeben mussten und vielfach keine finanziellen Möglichkeiten hatten, ihre Zucht auf einem eigenen Hof weiterzuführen. Dies gilt vor allem (aber nicht nur) für die Züchter auf dem ehemaligen Gebiet der DDR.
Wie gesagt: Stämme müssen gepflegt werden. Dabei sagt der Name des Pferdes natürlich nichts aus, sondern seine Eigenschaften. Wer meint, er kann einen schwach vererbenden Stutenstamm, innerhalb von drei Generationen auf Leistung trimmen, hat Recht. Dies bedingt aber, dass man über zwei bis drei Generationen mindestens eine Nachwuchsstute erhält, mit der man dann weitermachen kann.
Dass Holland im Springen und in der Dressur mit vorne dabei ist, braucht nicht zu wundern. Da waren sie übrigens in den 30er Jahren schon einmal, zumindest in der Dressur. Die Gelderländer waren als Fahrpferde damals berühmt und übrigens auch bewusst auf Spektakel gezogen (sie hatten nicht nur ordentlich zu treten und Zugkraft zu beweisen, sondern mussten auch Showmanship beweisen). Eine stolze Haltung mit hoher Aufrichtung, was zudem ein einigermaßen feuriges Temperament (also Geist) erforderte. Dass aus diesen Pferden, die Intelligenz und gewaltiges Gangvermögen bei problematischem Exteurieru, angepaart zunächst mit Edelblut und anschließend konsolidiertem Dressur- oder Springblut hochklassige Pferde für den Sport entstanden, muss nicht verwundern. Für die Weiterführung ihrer Zucht werden sie weiterhin auf Edelblut und (bevorzugt deutsche und französische) Hengste bzw solchen mit deutschem oder französischem züchterischen Background zurückgreifen müssen. Das wissen sie aber auch.
Bei den Belgiern ist das in den Fällen ähnlich, in denen ihre Pferde ebenfalls auf Gelderländer Blut zurückgehen.
Die Arroganz gegenüber den holländischen und belgischen Stutenstämmen ist aus deutscher Sicht also nicht angebracht, nur weil bis in die 70er Jahre hinein der holländische Fahrsport noch genug Geld für die Züchter abgeworfen hat. Lediglich deshalb sind die Holländer etwas später an die Fleischtöpfe in Springen und Dressur gekommen. Holländer sind Kaufleute, die sich darauf konzentrieren, wo am meisten Kasse zu machen ist und das dann konsequent durchführen. Nur für den Renn- und Vielseitigkeitssport wäre ihre Gelderländer und die daraus entstandene KWPN-Stutenbasis nicht in ausreichendem Maße geeignet.
Bei den Oldenburgern, die als reine Kutsch- und Fahrpferde gedacht werden, ist es ähnlich. Viele Oldenburger Stutenstämme finden sich auch in Holland wieder. Schwere, bewegungsstarke Hengste mit enormer Knieaktion wie Gruson haben in beiden Zuchten gewirkt. Auch die Oldenburger Zucht hat etwas länger gebraucht, um den Status zu erhalten, den sie jetzt hat.
Es kommt also darauf an, wie eine Stute die ihr zugedachten Aufgaben erfüllen kann, um sie als wertvoll einzustufen und nicht, ob sie bzw. ihr Stamm zu einer Zeit Spring- und Dressurpferde geliefert hat, als sich ihr Züchter dafür überhaupt noch nicht interessiert hat. Die punktuelle Verstärkung der Stute, die über Generationen auch eine andere Nutzung ermöglicht, als dies bisher der Fall war, erfolgt durch den Hengst. Die Grundqualität muss bei der Stute liegen, oder man macht es wie in Deutschland und dichtet einem Hengst Wunderdinge bei der Vererbung an, auf dass innerhalb zweier Generationen jede noch so durchschnittliche oder gar schlechte Stute Nachkommen auf höchster Ebene vorweisen kann, wenn der Nachkomme nur in die richtigen Hände kommt.
Was Belgien betrifft: Sie hatten relativ wenig brauchbare Mutterstämme (wenn sie nicht gerade das holländische Gelderländer Blut führten). Was haben sie also gemacht? Wie du richtig sagst: Sie haben auf deutsche Genetik (deutsche Hengste) gebaut, gerne auch im Zusammenhang mit Vollblütern.
Und wo kamen die deutschen Hengste her? Aus deutschen Stutenstämmen, auch wieder im Zusammenspiel mit mehr oder weniger Vollblut. Belgier, teilweise Holländer (auf deren Gelderländer Stutenstämmen auch immer noch sehr viele Pferde zurückgehen) nutzen also unsere Hengste besser als wir. Es ist richtig, dass in der Regel drei, besser vier Generationen ausreichen, um aus dem Nichts etwas herauszustampfen, wenn man nur konsequent genug nach denjenigen Hengsten Ausschau hält, die man für den jeweiligen Zweck braucht. Da ist es eben nicht der Stutenstamm der Mutter, sondern die der Väter (aber selbst das ist, wie ich unten noch schreiben werde, etwas oberflächlich betrachtet). Leichter und zuverlässiger ist es trotzdem, wenn man die guten Eigenschaften schon in der Stute verankert hat.
Was die Trakehner betrifft: Sie haben nach wie vor, wenn man ihre geringe Kopfzahl betrachtet, eine ganz gute sportliche Ausbeute, auch wenn die sich hauptsächlich in der Vielseitigkeit niederschlägt. Alles andere wäre auch ein Wunder gewesen; denn nach dem Zweiten Weltkrieg war nicht nur der Aderlass der Pferde entscheidend, sondern vor allem auch die Tatsache, dass die alten Züchterfamilien alles aufgeben mussten und vielfach keine finanziellen Möglichkeiten hatten, ihre Zucht auf einem eigenen Hof weiterzuführen. Dies gilt vor allem (aber nicht nur) für die Züchter auf dem ehemaligen Gebiet der DDR.
Wie gesagt: Stämme müssen gepflegt werden. Dabei sagt der Name des Pferdes natürlich nichts aus, sondern seine Eigenschaften. Wer meint, er kann einen schwach vererbenden Stutenstamm, innerhalb von drei Generationen auf Leistung trimmen, hat Recht. Dies bedingt aber, dass man über zwei bis drei Generationen mindestens eine Nachwuchsstute erhält, mit der man dann weitermachen kann.
Dass Holland im Springen und in der Dressur mit vorne dabei ist, braucht nicht zu wundern. Da waren sie übrigens in den 30er Jahren schon einmal, zumindest in der Dressur. Die Gelderländer waren als Fahrpferde damals berühmt und übrigens auch bewusst auf Spektakel gezogen (sie hatten nicht nur ordentlich zu treten und Zugkraft zu beweisen, sondern mussten auch Showmanship beweisen). Eine stolze Haltung mit hoher Aufrichtung, was zudem ein einigermaßen feuriges Temperament (also Geist) erforderte. Dass aus diesen Pferden, die Intelligenz und gewaltiges Gangvermögen bei problematischem Exteurieru, angepaart zunächst mit Edelblut und anschließend konsolidiertem Dressur- oder Springblut hochklassige Pferde für den Sport entstanden, muss nicht verwundern. Für die Weiterführung ihrer Zucht werden sie weiterhin auf Edelblut und (bevorzugt deutsche und französische) Hengste bzw solchen mit deutschem oder französischem züchterischen Background zurückgreifen müssen. Das wissen sie aber auch.
Bei den Belgiern ist das in den Fällen ähnlich, in denen ihre Pferde ebenfalls auf Gelderländer Blut zurückgehen.
Die Arroganz gegenüber den holländischen und belgischen Stutenstämmen ist aus deutscher Sicht also nicht angebracht, nur weil bis in die 70er Jahre hinein der holländische Fahrsport noch genug Geld für die Züchter abgeworfen hat. Lediglich deshalb sind die Holländer etwas später an die Fleischtöpfe in Springen und Dressur gekommen. Holländer sind Kaufleute, die sich darauf konzentrieren, wo am meisten Kasse zu machen ist und das dann konsequent durchführen. Nur für den Renn- und Vielseitigkeitssport wäre ihre Gelderländer und die daraus entstandene KWPN-Stutenbasis nicht in ausreichendem Maße geeignet.
Bei den Oldenburgern, die als reine Kutsch- und Fahrpferde gedacht werden, ist es ähnlich. Viele Oldenburger Stutenstämme finden sich auch in Holland wieder. Schwere, bewegungsstarke Hengste mit enormer Knieaktion wie Gruson haben in beiden Zuchten gewirkt. Auch die Oldenburger Zucht hat etwas länger gebraucht, um den Status zu erhalten, den sie jetzt hat.
Es kommt also darauf an, wie eine Stute die ihr zugedachten Aufgaben erfüllen kann, um sie als wertvoll einzustufen und nicht, ob sie bzw. ihr Stamm zu einer Zeit Spring- und Dressurpferde geliefert hat, als sich ihr Züchter dafür überhaupt noch nicht interessiert hat. Die punktuelle Verstärkung der Stute, die über Generationen auch eine andere Nutzung ermöglicht, als dies bisher der Fall war, erfolgt durch den Hengst. Die Grundqualität muss bei der Stute liegen, oder man macht es wie in Deutschland und dichtet einem Hengst Wunderdinge bei der Vererbung an, auf dass innerhalb zweier Generationen jede noch so durchschnittliche oder gar schlechte Stute Nachkommen auf höchster Ebene vorweisen kann, wenn der Nachkomme nur in die richtigen Hände kommt.

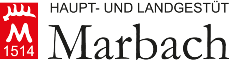




Kommentar